1. Grundlagen: Volumenstrom, Strömungsgeschwindigkeit und Querschnitt
1.1 Definition: Volumenstrom (Q) und Einheiten
Der Volumenstrom beschreibt, wieviel Volumen eines Mediums (z. B. Wasser) pro Zeiteinheit durch eine Rohrleitung fließt. In der Technik werden typische Einheiten verwendet:
-
m³/s (Kubikmeter pro Sekunde)
-
m³/h (Kubikmeter pro Stunde)
-
l/s oder l/min (Liter pro Sekunde / Minute)
Die Umrechnung ist:
wobei
-
= Querschnittsfläche des Rohrs
-
= Strömungsgeschwindigkeit
Wenn du also den Innendurchmesser eines Rohres (d) kennst, berechnest du den Querschnitt .
1.2 Strömungsgeschwindigkeit (v) und typische Werte
Die Geschwindigkeit des Mediums hängt von Anwendung und Rohrsystem ab. In Trinkwasser-Installationen sind oft Richtwerte zwischen 0,5 und 2,0 m/s üblich, um Druckverluste und Geräusche zu begrenzen. In industriellen Systemen kann man höhere Werte wählen (z. B. 2–4 m/s).
Die Geschwindigkeit ergibt sich umgekehrt aus:
Ein Beispiel aus der Praxis: Wenn ein DN 50-Rohr (ca. 50 mm Innendurchmesser) einen Volumenstrom von 7 l/min führt, ergibt sich eine Geschwindigkeit in m/s – das lässt sich wiederum in Druckverluste umrechnen. Solche Berechnungsbeispiele findest du auch auf Haustechnikseiten wie HaustechnikVerstehen.
1.3 Weitere Einflussfaktoren: Viskosität, Turbulenz & Reibung
Wasser ist in vielen Fällen ein sogenanntes newtonsches Fluid, bei dem die Viskosität konstant ist. Dennoch spielen Reibungsverluste an der Rohrwand eine wichtige Rolle.
-
Für Strömungen mit niedriger Geschwindigkeit können laminar (< ~Reynolds-Zahl 2300) oder turbulent sein
-
Die Reynolds-Zahl (Re) entscheidet, ob die Strömung laminar oder turbulent ist
-
In turbulenten Strömungen ist die Rohrreibungszahl λ wichtig – sie kann über das Moody-Diagramm abgelesen werden.
-
Die Rohrrauhigkeit (z. B. bei Kunststoff- oder Metallrohren) beeinflusst λ
Für laminare Strömung gilt das Hagen-Poiseuille-Gesetz:
wobei der Rohrradius, die dynamische Viskosität und die Länge sind.
In realen Systemen liegt in vielen Fällen turbulente Strömung vor, und du musst Verluste nach Darcy-Weisbach oder anderen Modellen berücksichtigen.
2. Normtabellen & Referenzwerte: Durchflussmengen in Rohrleitungen
Damit du nicht alles jedes Mal neu berechnen musst, existieren Normtabellen und Vergleichswerte – abhängig von Nennweite, Geschwindigkeit oder Gebrauchsanwendungen.
2.1 Tabelle: Durchsatz bei festen Geschwindigkeiten (Dürholdt / Typenblatt)
Eine häufig genutzte Tabelle gibt an, welche Volumenstromwerte (in m³/h) bei bestimmten Nennweiten bei v = 1 m/s und v = 2 m/s erreichbar sind.
| DN (mm) | Q bei 1 m/s (m³/h) | Q bei 2 m/s (m³/h) |
|---|---|---|
| 6 | 0,10 | 0,20 |
| 10 | 0,28 | 0,56 |
| 15 | 0,65 | 1,30 |
| 20 | 1,15 | 2,30 |
| 25 | 1,80 | 3,60 |
| 32 | 3,00 | 6,00 |
| 40 | 4,50 | 9,00 |
| … | … | … |
… und so weiter bis zu DN 500. Diese Tabelle ist sehr nützlich, um rasch Abschätzungen zu machen.
2.2 Richtwerte für Wasserleitungen & Frank GmbH Tabelle
Die Firma Frank GmbH hat eine Tabelle mit Durchflussmengen (in l/h), Nennweite, Querschnitt und Geschwindigkeit bereitgestellt.
Solche Tabellen berücksichtigen oft schon eine typische Strömungsgeschwindigkeit als Bemessungsgrundlage.
2.3 Dimensionierung nach DIN / Normen (z. B. DIN 1988-300 & EN 806-3)
Für Trinkwasserinstallationen in Deutschland ist die Normenkombination DIN 1988 und EN 806-3 relevant. Die DIN 1988-300 umfasst das differenzierte Rechenverfahren.
Die vereinfachte Methode der EN 806-3 erlaubt, für „Normal-Installationen“ mit Tabellenwerten die Rohrdurchmesser zu ermitteln, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind.
Aus der Norm:
-
In einem typischen Einfamilienhaus darf die vereinfachte Methode angewandt werden (bis ca. 6 Wohneinheiten)
-
Die Mindestversorgungsdrücke und hygienischen Anforderungen müssen eingehalten werden
-
Für komplexe Anlagen oder große Systeme ist das differenzierte Verfahren erforderlich
2.4 Weitere Vergleichstabellen (GPM / US-Einheiten, industrielle Werte)
In internationalen Tabellen findest du Durchflusswerte in GPM (Gallons per Minute) oder für industrielle Anwendungen. Beispiel: USA-Tabellen zeigen Rohrgrößen und Flussraten bei bestimmten Geschwindigkeiten.
Solche Daten können hilfreich sein, wenn du mit internationalen Systemen arbeitest oder Vergleichswerte brauchst.
3. Beispielrechnungen: Von Tabelle zur Konkreten Anwendung
3.1 Beispiel: Rohrdimensionierung eines kleinen Systems
Angenommen, du planst eine Wasserleitung mit einem Volumenstrom von 1,8 m³/h (entspricht 0,5 l/s). Welche Nennweite passt bei einer Zielgeschwindigkeit von ~1,5 m/s?
-
Umstellen der Formel:
-
-
-
Daraus ergibt sich ein Durchmesser
Damit käme eine Nennweite DN 20 oder DN 25 in Frage. Aus Normtabellen (z. B. Dürholdt) siehst du, dass bei DN 20 und 1,5 m/s ein Volumenstrom von ~1,72 m³/h möglich ist – gut im Rahmen.
3.2 Beispiel: Umrechnung aus einer bestehenden Tabelle (Frank GmbH)
Angenommen, du nimmst Werte aus der Frank-Tabelle:
-
Nennweite 50 mm → Durchfluss Q = 7 000 l/h (angenommen)
-
In m³/h: 7 000 l/h = 7 m³/h
-
Um die Geschwindigkeit v zu berechnen:
Mit :
Das ist eine relativ hohe Geschwindigkeit für Trinkwasser, aber in industriellen Anwendungen durchaus denkbar.
3.3 Einfluss von Reibungs- und Längenverlusten (Darcy-Weisbach)
Wenn das Rohr lang ist oder Bögen enthält, erhöhen sich die Druckverluste. Die Gleichung lautet:
-
= Rohrreibungszahl (aus Moody-Diagramm)
-
= Länge des Rohres
-
= Innenrohrdurchmesser
-
= Dichte des Mediums
-
= Geschwindigkeit
Der so berechnete Druckverlust kann mit der vorhandenen Druckquelle (z. B. Pumpe, Versorgungsdruck) verglichen werden – und ggf. wird ein größerer Durchmesser gewählt, um Verluste zu minimieren.
4. Typische Vergleichswerte: Häufig verwendete Tabellen im Überblick
4.1 Tabelle: Dürholdt – typische Werte bei 1 m/s und 2 m/s
(siehe Abschnitt 2.1)
4.2 Tabellen von Frank GmbH
Sie geben Durchflussmengen in l/h für verschiedene Nennweiten und geschätzte Geschwindigkeiten.
4.3 Tabellen für Kunststoffrohre (z. B. PP-Glattrohr)
Bei sehr glatten Innenflächen (z. B. PP-Glattrohr mit geringer Rauigkeit ~0,007 mm) lassen sich höhere Flusswerte erzielen. Bauernfeind hat Beispielwerte zur Durchflussberechnung für solche Rohre veröffentlicht.
4.4 Tabellen für industrielle Anwendungen / US-Tabellen
Zur Orientierung: In US-Tabellen findest du z. B. GPM-Werte je Inch-Rohr und bestimmte Geschwindigkeiten.
5. Tipps & Praxiswissen: So nutzt du Durchflusstabellen richtig
5.1 Spannungsspielraum berücksichtigen
Tabellen geben idealisierte Werte unter Annahme eines konstanten Drucks und optimaler Bedingungen. In der Praxis musst du Puffer einbauen für Druckverluste, Pumpeneffizienz, Wellen, Temperaturänderungen etc.
5.2 Sicherheit und Normeinsatz beachten
Wenn du gemäß DIN/EN arbeitest (z. B. bei Trinkwasserinstallationen), halte dich an die zugelassenen Methoden (vereinfachte Verfahren oder differenzierte Berechnung) und normative Voraussetzungen. (Siehe DIN 1988-300 & EN 806-3)
5.3 Vergleich: Viel kleine Rohre vs. ein großes Rohr
Zur gleichen Strömungsgeschwindigkeit steigt der Volumenstrom mit dem Querschnitt. Ein Rohr mit doppeltem Durchmesser hat den vierfachen Querschnitt (und damit fast vierfachen Volumenstrom).
5.4 Validierung durch Simulation oder Software
Bei komplexen Anlagen lohnt es sich, mit Simulationssoftware (CFD, hydraulische Auslegungstools) zu validieren oder professionelle Tools mit genauer Reibungsmodellierung zu nutzen.
5.5 Grenzen der Tabellen & Faustregeln erkennen
Tabellen helfen vor allem für erste Abschätzungen. Bei extremen Bedingungen (lange Leitungen, hohe Drücke, spezielle Medien, gasförmige Strömung etc.) sind sie oft nicht ausreichend – dort muss technisch berechnet werden.
6. Empfehlung
-
Durchflussmenge von Rohren ist eine zentrale Größe in der technischen Planung – und lässt sich über Formel, Tabellen und Normverfahren bestimmen.
-
Tabellen (wie Dürholdt, Frank etc.) geben rasche Orientierung für typische Geschwindigkeiten und Nennweiten.
-
Für Trinkwasser-Installationen gelten Normen wie DIN 1988-300 und EN 806-3, welche Tabellen oder Rechenverfahren vorgeben.
-
In der Praxis müssen Reibungs- und Druckverluste, Rohrrauhigkeit, Längen, Bögen und Puffer berücksichtigt werden.
-
Bei komplexen Systemen ergänze die Nutzung von Software, Simulation oder professionellen Berechnungsmethoden.
Wenn du möchtest, kann ich dir eine interaktive Excel-Tabelle oder ein Berechnungs-Tool mit Vorlagen zur Verfügung stellen, sodass du schnell eigene Durchflusstabellen erzeugen kannst. Möchtest du das?
Häufige Fragen zur „Durchflussmenge Rohr Tabelle“
-
Welche Geschwindigkeit sollte man bei Trinkwasserleitungen wählen?
Typisch sind 0,5 bis 2,0 m/s – oberhalb steigen Reibung, Geräusche und Druckverluste überproportional. -
Stimmt ein doppelter Rohrdurchmesser mit doppeltem Fluss?
Nein – der Volumenstrom sk
7. Berechnungsformeln im Detail: So wird die Durchflussmenge exakt berechnet
7.1 Grundformel zur Durchflussmengenberechnung
Die einfachste und am häufigsten verwendete Formel lautet:
Dabei ist:
-
= Volumenstrom (m³/s)
-
= Querschnittsfläche des Rohres (m²)
-
= Strömungsgeschwindigkeit (m/s)
Für runde Rohrquerschnitte wird die Fläche wie folgt berechnet:
Je größer der Durchmesser , desto mehr Volumen kann bei gleicher Geschwindigkeit transportiert werden.
Ein praktisches Beispiel:
Ein Rohr mit 40 mm Innendurchmesser und einer Strömungsgeschwindigkeit von 1 m/s ergibt:
Damit kann man schnell erkennen, wie eng Durchmesser und Geschwindigkeit miteinander verbunden sind.
7.2 Alternative Formel mit Druckverlust und Reibung
Für realistische Anlagen mit langen Leitungen oder Bögen reicht die einfache Formel nicht aus. Hier kommt die Darcy-Weisbach-Gleichung ins Spiel:
-
: Höhenverlust (Druckverlust durch Reibung in m Wassersäule)
-
: Rohrreibungskoeffizient (abhängig von Material & Rauigkeit)
-
: Rohrlänge (m)
-
: Rohrdurchmesser (m)
-
: Erdbeschleunigung (9,81 m/s²)
Über diese Gleichung kann man ermitteln, wie viel Druckverlust durch Reibung entsteht. Besonders bei Pumpenanlagen ist das entscheidend, um die richtige Dimensionierung zu wählen.
7.3 Einfluss der Temperatur auf die Durchflussmenge
Die Temperatur beeinflusst die Viskosität (Zähflüssigkeit) des Mediums.
-
Kaltes Wasser ist viskoser → geringere Durchflussmenge
-
Warmes Wasser oder Öl mit niedriger Viskosität → höherer Durchfluss
Beispiel:
Wasser bei 20 °C hat eine dynamische Viskosität von ca. , bei 60 °C sinkt dieser Wert auf etwa .
Das bedeutet: Warmes Wasser fließt fast doppelt so „leicht“ durch die gleiche Rohrleitung.
7.4 Korrekturfaktoren für verschiedene Medien
Nicht nur Wasser, sondern auch andere Medien (z. B. Öle, Gase, Chemikalien) können durch Rohrleitungen fließen. Hierbei müssen Korrekturfaktoren für Dichte und Viskosität berücksichtigt werden.
Beispielhafte Korrekturfaktoren:
| Medium | Dichte (kg/m³) | Korrekturfaktor auf Wasserbasis |
|---|---|---|
| Wasser | 1000 | 1,00 |
| Heizöl | 850 | 0,85 |
| Luft | 1,2 | 0,0012 |
| Glykol-Wasser (40 %) | 1060 | 1,06 |
Diese Faktoren helfen, die Berechnungen an unterschiedliche Medien anzupassen, damit die Durchflusswerte realistisch bleiben.
8. Materialabhängigkeit der Durchflussmenge: Stahl, Kupfer, Kunststoff
8.1 Stahlrohre
Stahlrohre sind robust, haben aber eine relativ raue Innenoberfläche. Das bedeutet: Höhere Reibung, geringere effektive Durchflussmenge.
Vorteile:
-
Hohe Druckfestigkeit
-
Gute Wärmebeständigkeit
Nachteile: -
Korrosionsanfällig (außer verzinkt)
-
Höherer Druckverlust durch Rauigkeit
8.2 Kupferrohre
Kupferrohre werden häufig in Trinkwasserinstallationen verwendet.
Sie sind glatter als Stahlrohre, was geringere Druckverluste zur Folge hat.
Vorteile:
-
Geringe Rauigkeit (~0,0015 mm)
-
Langlebig
-
Einfach zu verarbeiten
Kupferrohre erlauben also bei gleichem Durchmesser höhere Durchflussraten als vergleichbare Stahlrohre.
8.3 Kunststoffrohre (PVC, PE, PP)
Kunststoffrohre sind heute Standard in der Haustechnik, besonders in der Trinkwasserversorgung, Abwassertechnik und Bewässerung.
Vorteile:
-
Sehr glatte Innenfläche (Rauigkeit < 0,007 mm)
-
Korrosionsfrei
-
Geringes Gewicht
Durch die glatte Innenfläche verringern sich Reibungsverluste drastisch, wodurch die effektive Durchflussmenge im Vergleich zu Metallrohren deutlich höher ist.
8.4 Vergleich der Rauigkeitswerte
| Rohrmaterial | Rauigkeit k (mm) | Bemerkung |
|---|---|---|
| Stahl (ungeschützt) | 0,05 – 0,15 | hohe Verluste |
| Verzinkter Stahl | 0,03 – 0,10 | mittlere Verluste |
| Kupfer | 0,0015 | sehr glatt |
| PVC/PE/PP | 0,007 | extrem glatt |
| Beton | 0,3 – 3,0 | sehr rau |
Diese Werte werden bei der Berechnung der Rohrreibungszahl (λ) und damit der Druckverluste herangezogen.
9. Druckverluste und Energieeffizienz
9.1 Warum Druckverluste entscheidend sind
Druckverluste bestimmen, wie viel Energie eine Pumpe aufbringen muss, um den gewünschten Durchfluss zu gewährleisten.
Ein zu kleiner Rohrdurchmesser führt zu:
-
Hohen Reibungsverlusten
-
Erhöhtem Energieverbrauch
-
Schnelleren Materialermüdungen
Ein zu großer Rohrdurchmesser dagegen:
-
Höhere Materialkosten
-
Geringere Strömungsgeschwindigkeit (Ablagerungsgefahr)
Die Kunst liegt in der optimalen Dimensionierung zwischen Effizienz, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit.
9.2 Druckverlust berechnen
Druckverlust (Δp) kann über die Darcy-Weisbach-Gleichung ermittelt werden:
Beispiel:
-
Rohrlänge: 30 m
-
Durchmesser: 25 mm
-
Dichte: 1000 kg/m³ (Wasser)
-
Geschwindigkeit: 1,5 m/s
-
Rohrreibungszahl: 0,03
Das entspricht ca. 0,405 bar Druckverlust – ein relevanter Wert, der in der Planung berücksichtigt werden muss.
9.3 Energieeinsparpotenzial durch optimale Dimensionierung
Mit einer guten Dimensionierung lässt sich der Pumpenenergieverbrauch um 10–20 % reduzieren.
Beispiel: Wenn du den Durchmesser nur um 5 mm erhöhst, kann sich der Druckverlust halbieren. Das spart langfristig erheblich Energie und Betriebskosten.
10. Tabellenanwendung in der Praxis
10.1 Vorgehensweise bei der Dimensionierung
-
Gewünschten Volumenstrom (Q) bestimmen
-
Empfohlene Strömungsgeschwindigkeit wählen (z. B. 1–2 m/s)
-
Rohrquerschnitt mit berechnen
-
Geeignete Nennweite aus Tabelle ablesen
-
Überprüfen: Druckverlust, Länge, Bögen, Material
So kannst du schnell entscheiden, welche Rohrgröße geeignet ist.
10.2 Beispiel einer Praxisanwendung
Ein Gartenbewässerungssystem benötigt 3 m³/h Wasser.
Zielgeschwindigkeit: 1,5 m/s.
→ Ein Rohr DN 25 wäre ideal.
Überprüfst du die Dürholdt-Tabelle, siehst du: DN 25 bei 1,5 m/s ergibt ca. 2,7 m³/h – perfekt!

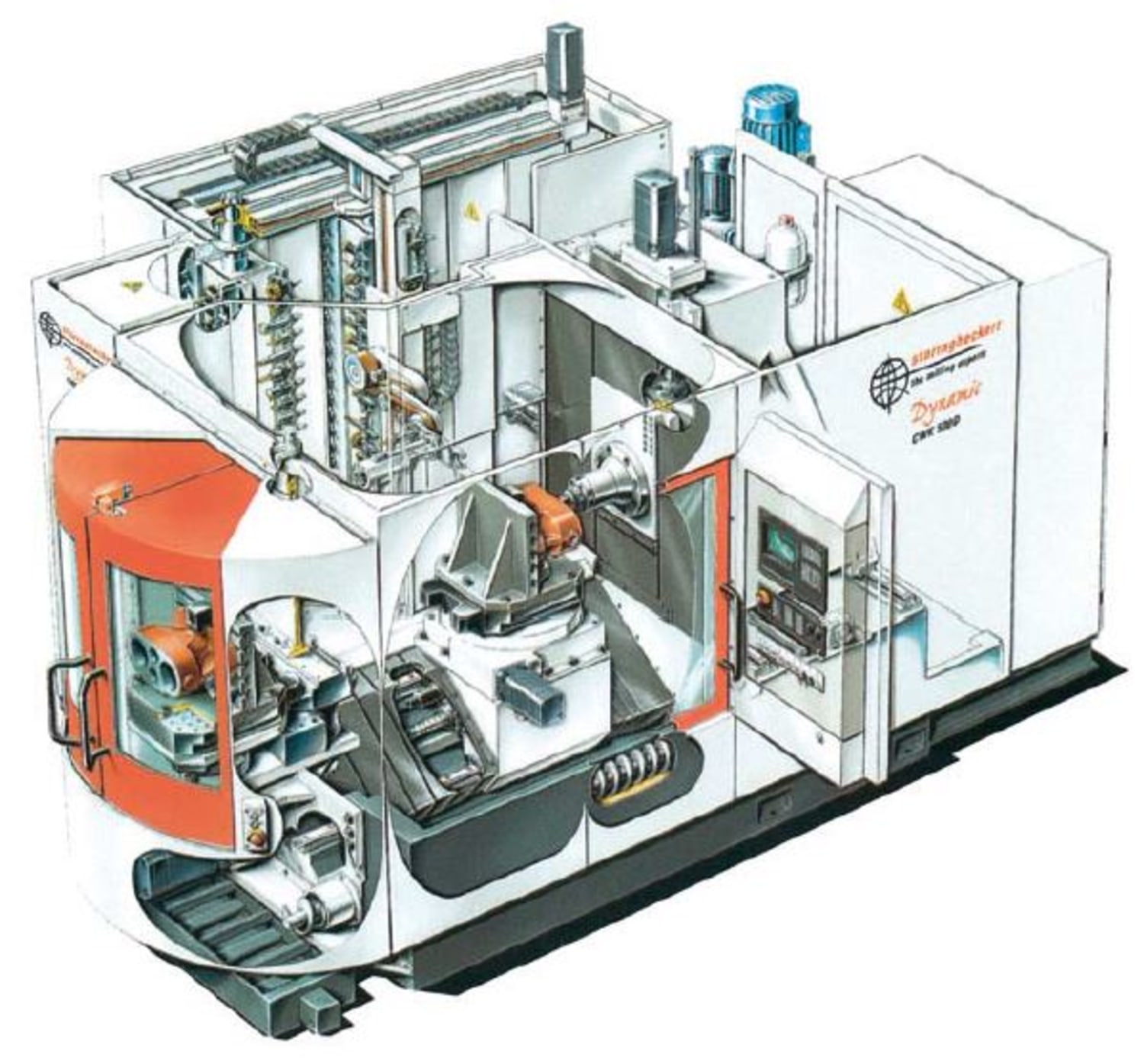

Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen
Hinweis: Nur ein Mitglied dieses Blogs kann Kommentare posten.